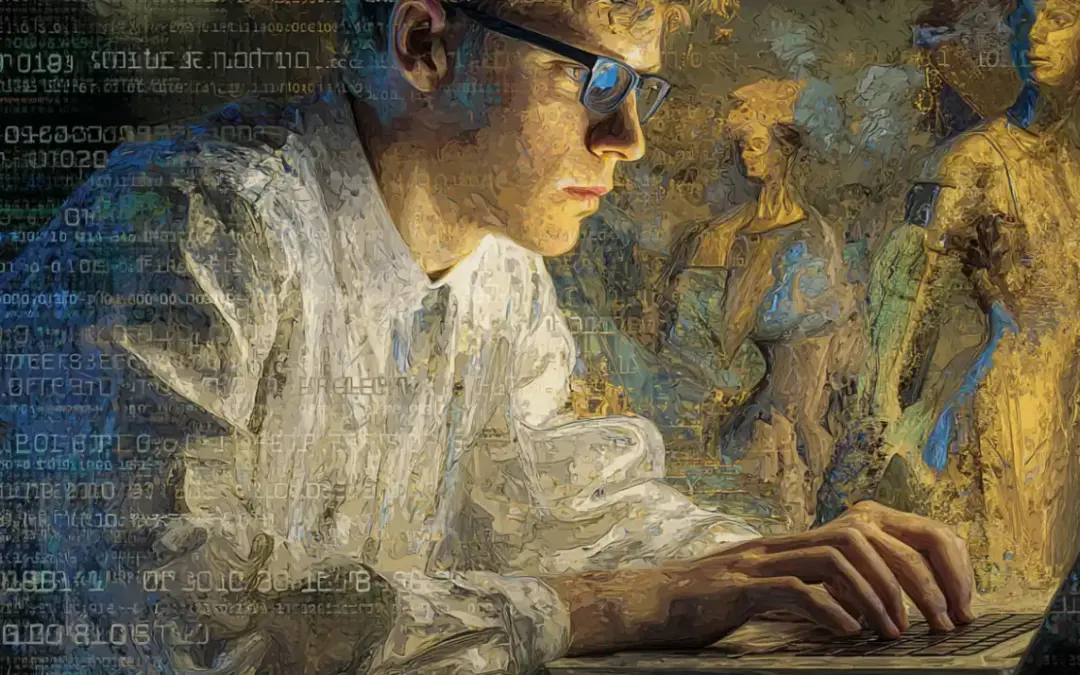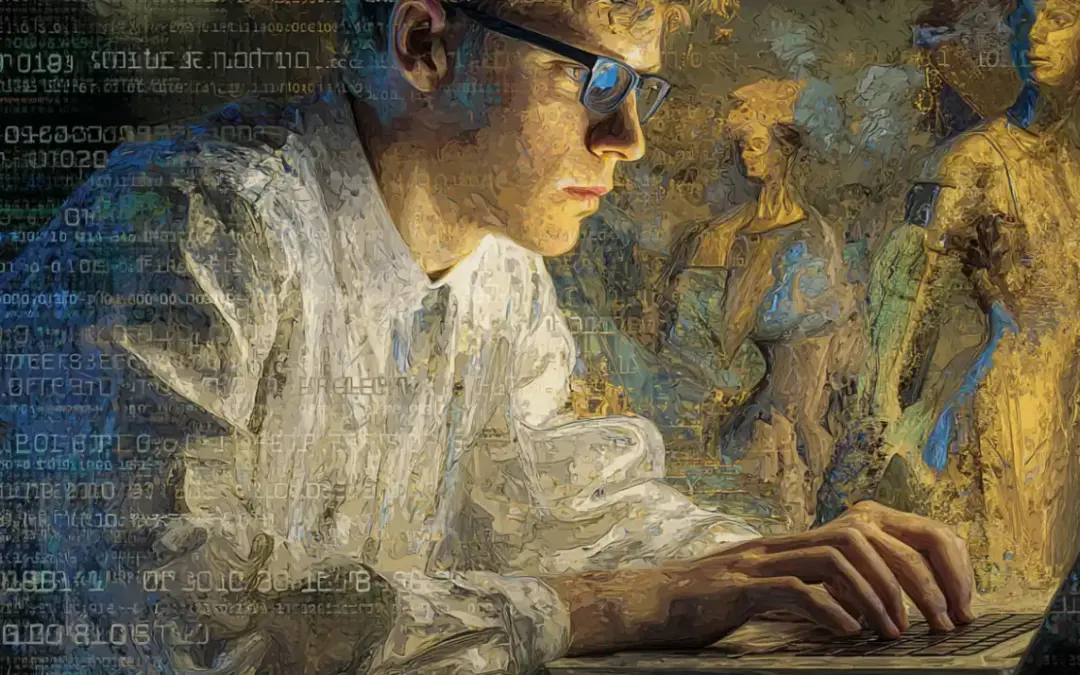
Okt. 3, 2025 | psql
Jetzt, wo du die Grundlagen und wichtigsten Befehle kennst, schauen wir uns ein paar praktische Tipps für den Admin-Alltag an. Damit kannst du PostgreSQL sicher betreiben und deine … Weiterlesen

Okt. 3, 2025 | psql
Egal wie stabil ein System ist – ohne Backups bist du im Notfall verloren. PostgreSQL bietet mit pg_dump und pg_restore mächtige Werkzeuge, um Datenbanken zu sichern und wiederherzustellen. … Weiterlesen

Okt. 3, 2025 | psql
PostgreSQL ist nicht nur eine klassische SQL-Datenbank – es ist ein Framework für Datenverarbeitung. Du kannst neue Datentypen, Funktionen und sogar eigene Programmiersprachen hinzufügen. 🔹 Erweiterungen verwalten Alle … Weiterlesen

Okt. 3, 2025 | psql
Ein Index ist wie ein Register in einem Buch: statt jede Seite durchzugehen, springt die Datenbank direkt an die richtige Stelle. Indizes machen Abfragen deutlich schneller – aber … Weiterlesen

Okt. 3, 2025 | psql
Eine Datenbank soll nicht nur Daten speichern, sondern auch sicherstellen, dass die Daten konsistent und eindeutig bleiben. Dafür gibt es Schlüssel und Constraints (Einschränkungen). 🔹 Primärschlüssel (Primary Key) … Weiterlesen